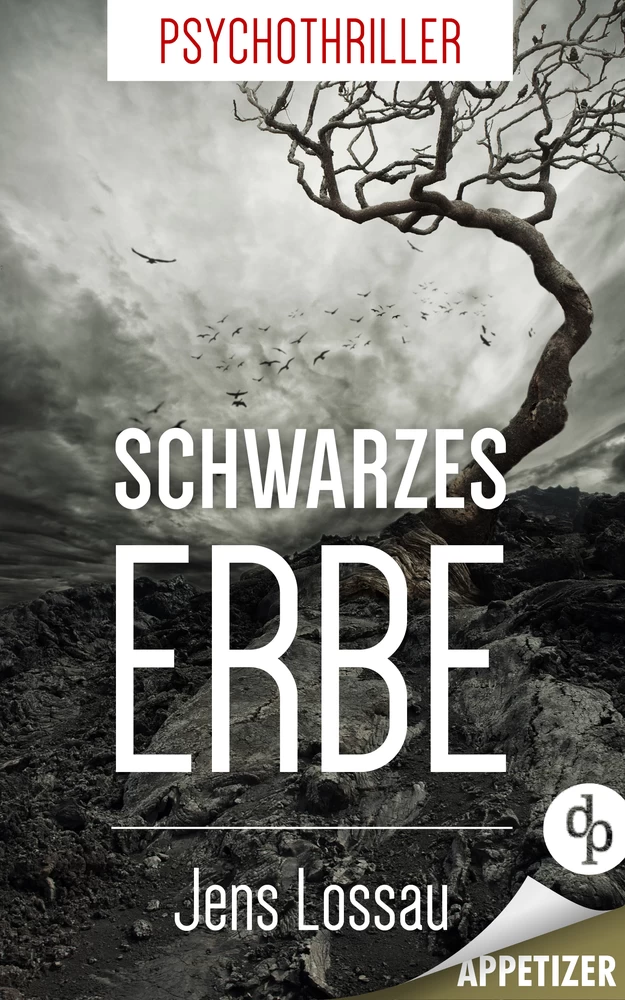Zusammenfassung
Ihr Comic wird weltweit verlegt und ist ein Bestseller.
Eigentlich könnte alles gut sein, aber Ben verändert sich und Lina trifft auf Menschen, die ihr bedrohlich erscheinen. Die Story scheint viele Menschen zu bewegen, aber was steckt wirklich dahinter? Nur Ben kennt die Wahrheit - oder wer noch?
Jens Lossaus Psychothriller erzählt einen bedrohlichen Alptraum über ein düsteres Kapitel der deutschen Geschichte. Dunkel und spannungsgeladen bis zum überraschenden Ende.
Folge Lina und Ben auf Facebook: https://www.facebook.com/schwarzeserbeebook
Video-Lesung mit Barbara Stoll: http://youtu.be/j08gMT66zZY
Über die Appetizer-Ausgabe
Unsere Appetizer Ausgaben dienen als erster Vorgeschmack auf ein komplettes E-Book. Wir sind der Meinung, dass Lesen Freude machen muss. Wer sich durch die ersten Kapitel eines E-Book „quält", wird keine Freude haben. Um festzustellen, ob ein E-Book den persönlichen Geschmack trifft, braucht es meist mehr als eine herkömmliche Leseprobe.
Deshalb möchten wir als Verlag unseren Lesern die Chance geben, das Werk bis zu einem bestimmten Punkt kostengünstig lesen zu können. Meist endet der Appetizer an einem spannenden Punkt. Wer dann weiterlesen möchte, hat Geschmack am Lesestoff gefunden und kann die Gesamtausgabe erwerben.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Der Raum, in dem Lina Kessler sterben würde, besaß keine Fenster, durch die sie in die Vergangenheit hätte blicken können. Sie stand in einem dunklen Schlauch, in dem es nach Fäulnis und vergorenem Wein roch.
So sah also das Ende aus: kein Licht, nur Moder und das ferne Rumoren des Infernos. Keine Chance mehr, Leben zu imitieren. Von den Flammen trennte sie lediglich ein Meter Gestein.
Das Ziehen in ihrer Schulter verwandelte sich in ein Brennen, das sich über ihre Brust ausbreitete. Eine unangenehme Hitze jagte plötzlich durch ihren Körper, ihr wurde schwindelig, Farben explodierten wie kleine Feuerwerke in der Dunkelheit. Ihre Finger griffen durch eine zähe Masse. Spinnweben, dick wie Zuckerwatte.
Lina wusste, dass sie nicht mehr zurück konnte. Über ihr wütete das Feuer. Sie konnte nicht einfach durch die Flammen in die Vergangenheit springen.
Ihr Magen krampfte sich zusammen, der Schmerz, der auf einem Hitzefloß durch ihren Körper raste, erreichte ihren Unterleib. Sie vernahm ein leises Stöhnen, hell und zerbrechlich, wie von einem Kind. Es dauerte mehrere Sekunden, bis sie merkte, dass dieses Geräusch aus ihrem Mund kam.
Sie wartete, bis der Schmerz etwas nachließ, wartete auf das heiße, feuchte Gefühl. Ihre Menstruation war immer unregelmäßig und zu den ungelegensten Zeiten gekommen, sie hatte deswegen immer Tampons mit sich herumgeschleppt. Jetzt hatte sie keine dabei. An alles hatte sie gedacht: an die Briefe, das Papier, die Waffen, die Fotos.
Keine Tampons.
Der Schmerz verglühte wie eine Kerzenflamme, der das Wachs ausging. Das Blut sickerte aus ihrer Schulter.
Lina rieb das Rädchen ihres Feuerzeuges. Ein ratschendes Geräusch entstand, eine bläuliche Flamme erstrahlte.
Über ihr schien ein zentnerschweres Gewicht zu Boden zu krachen.
Sie sah an sich hinunter. Ihr schwarzer Kapuzenpullover war an mehreren Stellen zerrissen. Dort, wo der Schuss sie gestreift hatte, war der Stoff blutgetränkt.
Vor ihrem Gesicht befand sich ein riesiges Spinnennetz. In einer Ecke baumelte ein eingesponnener Sack von der Größe einer Maus.
Der Raum, der sich schlauchförmig vor ihr erstreckte, war so niedrig, dass sie kaum aufrecht stehen konnte, obwohl sie nur 1,74 Meter groß war. Sie machte einen Schritt nach vorne. Die Sohlen ihrer schwarzen Turnschuhe strichen über Mörtel.
Die Wände des Raumes bestanden aus groben Sandsteinen, die sich mit Feuchtigkeit voll gesogen hatten. Schimmelpilze überwucherten Leitungen und Rohre, die aus der Mauer wuchsen.
Am Ende des Raumes befanden sich drei Weinfässer. Eines war in der Mitte auseinandergebrochen. Auf dem grünstichigen Holz prangte die Zahl 1958.
Lina verbrannte sich den Daumen an der Flamme, das Licht erlosch. Wieder gab es nur Gerüche: Schwefel, Fäulnis, vergorener Wein.
Über ihr rumpelte es.
Wie lange würde es dauern, bis die Flammen, die die Halle fraßen, den Weg durch die Klapptür fanden? Wie lange würde der Sauerstoff reichen? Würde sie ersticken? Würde sie bei lebendigem Leib verbrennen? Oder würde die Decke einfach nachgeben und sie unter sich begraben?
Lina rieb den Feuerstein erneut.
In der linken Ecke türmten sich Kartons, die so trocken waren, dass sie Risse bekamen, sobald sie die mit den Fingerspitzen berührte. In einem der Kartons entdeckte sie eine alte Weihnachtsdekoration. Sie zog eine bunte Lichterkette hervor und verteilte sie im Raum. Sie fand eine Steckdose. Sie glaubte zwar nicht, dass es noch Strom gab (schließlich ging über ihr die Welt unter), aber ein Versuch konnte nicht schaden.
Die bunten Lichter erglommen, diamantweiß, smaragdgrün, rubinrot, türkisfarben, saphirblau.
Lina setzte sich auf den Boden, umringt vom hellen Leuchten. Das Licht sah schön aus. Die Lämpchen sonderten einen irgendwie elektrischen Geruch ab, der sie an vergangene Weihnachtsfeste erinnerte.
Auf dem Boden lag eine Spiegelscherbe und reflektierte das Licht. Lina betrachtete ihr Gesicht darin.
Ihr halblanges, rotes Haar klebte ihr am Kopf, ihre Augen lagen zu tief in ihren Höhlen, und ein hässlicher Kratzer zog sich über ihre rechte Wange.
»Du wirst hier sterben.«
Um Himmels Willen, war das ihre Stimme gewesen? Es klang wie das Organ einer alten, kranken Frau.
Lina blickte durch das rote und grüne und blaue Licht zum anderen Ende ihres Verlieses, zur Holztreppe, die sie vor wenigen Minuten hinab gestiegen war, sah zu der Falltür, die die Geräusche des Infernos abgeschnitten hatte, und lehnte ihren Kopf gegen eines der Fässer. Die Schmerzen erreichten ihr Gehirn erneut, wenn auch nur noch gedämpft.
Lina befand sich in einem Raumschiff, das die Erde verließ. Der Gedanke gefiel ihr. Sie hatte es immer gemocht, sich zusammen mit den Stoffraben in ihr Bett zu kuscheln und sich vorzustellen, sie befände sich in einem Ufo. Nichts konnte mehr in ihre Welt eindringen.
Sie schwebte im luftleeren Raum.
Sie holte Hugin aus ihrem Rucksack. Der Stoffrabe war ungefähr zwanzig Zentimeter groß und schaute sie etwas dümmlich an. Auch er war blutbefleckt, aber das Blut war älter, es stammte nicht von den neuen Leichen. Sie setzte ihn vor sich auf den Boden.
»Alles in Ordnung mit dir, Hugin?«
Der Stoffrabe nickte.
»Du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt wird alles gut. Wir sind in Sicherheit, wir befinden uns in einem Raumschiff. Bist du traurig, dass Ben nicht bei uns ist?«
Wieder nickte Hugin.
»Ich bin auch traurig. Aber wir werden ihn bald wieder sehen.«
Lina zog einen Stapel Schwarz-Weiß-Fotografien aus ihrem Rucksack. Die meisten zeigten einen dünnen jungen Mann mit halblangen Haaren und schüchternem Lächeln.
Es gab auch Fotos von ihr selbst, aber sie erkannte sich darauf nicht wieder, hauptsächlich, weil sie auf ihnen lächelte.
Die Wunde auf ihrem Oberarm sah obszön aus, als hätte ein Kind mit einem Filzstift auf ihrer Haut herumgekritzelt und die Farben Karmesinrot und Schwarz verwendet.
Sie holte ein kleines Notizbuch und einen Kugelschreiber aus dem Rucksack. Auf dem Umschlag war eine Pfauenfeder abgebildet. Sie schlug es auf und las ihren einzigen Eintrag:
Leben heißt, dass die anderen einen kriegen können.
Sie hatte einen Packen Papier dabei, weil sie angenommen hatte, im Verlauf des letzten Tages auf der Welt zum Zeichnen zu kommen. Was für eine naive Idee! An Zeichenstifte hatte sie nicht gedacht.
Sie nahm den Kugelschreiber und tauchte ab:
Ich habe Zeit. Das Letzte, was mir bleibt, ist Zeit, in die ich zurückgehen kann, um das Bild zusammenzusetzen. Bilder sind wichtig, um zu verstehen. Fast so wichtig wie Gerüche.
Ich habe Ben mal gefragt, wie die Zeit riecht. Blöde Frage.
Nach Staub. Tabak. Menschen. Leichen. Asche.
Ich befinde mich in einem Traum. Aber der Traum ist eine gesprungene Glasfläche, gebrochenes Eis.
Ich glaube nicht an das Schicksal. Nichts ist vorherbestimmt. Das ist ja das Unheimliche. Dinge geschehen einfach. Nur wenn man wach ist, kann man sie beeinflussen.
Wann war ich schon wach?
1
Im ersten Moment wusste Lina nicht, wo sie war. Die Luft roch anders als in ihrem Zimmer daheim. Frischer. Das lag an dem fremden Haus. In dem fremden Haus lebte jemand, der Gerüche hinterließ. Es roch nach Gewürzen und Pflanzen; nach Kaffee und verstaubten Büchern; nach den Spänen, die beim Bleistiftanspitzen entstehen.
Sie blickte von der schrägen Holzdecke durch das Dachlukenfenster zu der Trauerweide, die im Garten stand. Die Sonne, die durch die Blätter fiel, war rot und genauso frisch wie die Luft.
Es war kurz nach sieben, der Wecker würde erst in einer Viertelstunde klingeln. Lina mochte diese Zeit des Tages am liebsten, wenn noch alles voller Erwartung war.
Das Zimmer war vollgestopft mit afrikanischen Masken und Trommeln, Grünpflanzen und Büchern. Das Dach lief spitz zusammen, wie bei einer hölzernen Pyramide.
Eigentlich handelte es sich um Onkel Flossies Arbeitszimmer. Er hatte die große Couch unter der Dachluke für sie mit frischer Bettwäsche bezogen. Zwischen ihren Füßen lagen Gilmour und Waters, Flossies Lieblingskater.
Sie hörte Schritte auf der Treppe, und eine Sekunde später erschien Onkel Flossies Kopf neben dem Geländer. In den Händen hielt er ein Tablett mit einer Tasse Kaffee und einem Teller mit Honighörnchen. Als er sah, dass Lina wach war, lächelte er.
»Schönen guten Morgen, die Dame. Na, schon beim Morgentraining?«
Onkel Flossie war ein kleiner kahlköpfiger Mann, auf dessen Nase eine altmodische schwarze Hornbrille saß. Seine Augen wurden an den Rändern von unzähligen Lachfältchen eingefasst. Er trug eine Gärtnerhose und ein weißes T-Shirt. Das Jackett, das er darüber gezogen hatte, passte überhaupt nicht dazu.
Lina streckte sich. »Morgen, Onkel Flossie.« Sie gähnte herzhaft. »Frühstück schon fertig?«
»Wie von Ihnen gewünscht, Fräulein Kessler.«
Er stellte das Tablett auf einen Rattansessel, nahm auf dem Fußboden Platz und griff sich ein Hörnchen. »Du gestattest«, sagte er und tunkte es in Linas Kaffee.
»Onkel Flossie, igitt, nicht! Jetzt schwimmen da lauter Bröckchen drin rum. Das ist widerlich.«
»Widerlich sind nur die Schnecken in meinem Garten, die fressen mir die ganzen Salatköpfe weg. Hast du gut geschlafen?«
Lina nickte. Natürlich hatte sie gut geschlafen, sie schlief immer gut, wenn sie bei Onkel Flossie war.
Gerhard Flossenburger war der Bruder ihrer Mutter. Lina war nicht ganz klar, warum die Talente in ihrer Familie so ungerecht verteilt waren, aber Onkel Flossie passte nicht in ihren Clan. Er hörte zu, erzählte Geschichten.
Er hatte ein Leben.
Bis vor wenigen Jahren hatte Onkel Flossie einen Trödelladen in der Mainzer Innenstadt besessen. Als Lina klein war, hatte sie sich dort gerne aufgehalten und in den engen Gängen gespielt. Der Laden war bis unter die Decke vollgestopft mit Kuriositäten: antike Möbel, uralte Lampen, Teddybären, deren Besitzer längst das Zeitliche gesegnet hatten, unheimliche Spiegel mit bizarrem Zierrand, starrende Porzellanpuppen aus dem letzten Jahrhundert.
Onkel Flossies Haus in Alzey war ebenfalls angefüllt mit Antiquitäten. Vor zwei Jahren hatte er eine Afrikareise unternommen, von der er mit allerhand Gepäck zurückgekehrt war - Dutzende von Trommeln, Masken und Speeren, weswegen man ihn am Zoll hatte verhaften wollen.
Sein Haus lag etwas außerhalb von Alzey, direkt an der Selz, einem kleinen, schmutzigen Bach, dessen Rauschen im hölzernen Pyramidenzimmer wie ein Flüstern klang.
Linas Mutter machte keinen Hehl daraus, dass sie ihren Bruder nicht ausstehen konnte. Sie war kein Freund des gesprochenen Wortes, und Onkel Flossie quatschte wie ein Wasserfall. Aber da ihre Mutter von einem Großen Egal, wie es Onkel Flossie nannte, umgeben war, machte sie sich nicht die Mühe, ihrer Tochter die Besuche bei dem Sechsundfünfzigjährigen zu untersagen.
Onkel Flossie bekam einen heftigen Hustenanfall. Er rauchte Kette, so lange Lina zurückdenken konnte. Sein Gesicht lief rot an, er beugte sich vornüber, hustete erneut, sodass ein beunruhigendes rasselndes Geräusch aus seiner Kehle flog.
»Alles in Ordnung?«
Onkel Flossie nickte mit tränenden Augen. Er holte eine dunkelbraune Zigarre aus seiner Tasche und steckte sie sich an. Der Rauch schwängerte die Luft.
Lina runzelte die Stirn. »Du solltest vielleicht etwas weniger rauchen.«
»Herrje, eine Predigt, und das am frühen Morgen.« Er stieß ein keuchendes Lachen aus. »Aber wo du recht hast, hast du recht.«
»Ich habe von dem Film geträumt«, sagte Lina und nahm sich ein Honighörnchen. »Hab geträumt, dass mich ganz viele von diesen abgemagerten KZ-Häftlingen verfolgen. Ich trug eine schwarze SS-Uniform. Wollte sie ausziehen, um den Leuten zu zeigen, dass es sich hier um einen Irrtum handelte, aber ich schämte mich irgendwie. Ich meine, ich wäre dann ja ... ähm, nackt gewesen.«
Sie hatten am Abend einen Spielfilm über ein KZ gesehen. Lina hatte sich bis eben nicht an den Albtraum erinnert, und plötzlich war es ihr ein bisschen peinlich, Onkel Flossie den Inhalt so unverblümt erzählt zu haben.
Onkel Flossie war ein großer Fan von Träumen, er maß ihnen viel Bedeutung bei. Er nickte, machte »Mhm, mhm« und fragte: »Was glaubst du, was bedeutet das?«
»Keine Ahnung. Ich meine, der Film hat mich irgendwie verfolgt, sozusagen.«
»Mhm, mhm ...«
»Aber ich fand es ... unangenehm ... nein, ich fand es schrecklich, dass ich eine Uniform anhatte.« Lina spürte, wie eine Gänsehaut über ihren Rücken kroch. »Wirklich schrecklich«, flüsterte sie.
Onkel Flossie zog an seiner stinkenden Zigarre. »Warum?« Wenn Onkel Flossie in diesem Ton eine Frage stellte, hatte Lina immer das Gefühl, dass er die Antwort längst kannte.
»Schrecklich, weil sich die Leute in mir täuschten. Schrecklich, weil ich die Uniform hätte ausziehen müssen und dann nackt gewesen wäre.«
Lina war vierzehn Jahre alt, und sie weigerte sich standhaft, sich vor anderen Menschen zu entblößen, auch nicht in der Schule beim Duschen nach dem Sport. Wie kam sie dazu, das Onkel Flossie zu erzählen? Es war geradezu anzüglich.
Ihre Mutter hatte sie einmal gefragt: »Wenn du bei Gerhard übernachtest ... da schläfst du aber schon in einem eigenen Bett, oder?« Subtil wie eine Gemeinschaftsbettpfanne.
Onkel Flossie war nie verheiratet gewesen. Alle paar Jahre schleppte er eine Freundin an, aber es war nie etwas Festes. Lina wunderte sich darüber, dass Menschen mit Argwohn reagierten, nur weil jemand allein mit seinen Katzen lebte.
»Warum war es dir unangenehm, die Naziuniform abzulegen?« Onkel Flossie beobachtete den blauen Qualm, der aus seinem Mund in Richtung Decke quoll.
»Weil die Leute nach mir gelangt haben. Weil sie Hilfe wollten. Und weil ich dann ungeschützt gewesen wäre. Ich wollte nicht nackt dastehen.« Sie vermied es zu erwähnen, dass sie momentan ihre Tage hatte und dieses Wissen mit in den Traum genommen hatte.
Onkel Flossie hustete und meinte dann, mehr zu sich selbst als zu Lina: »Manchmal muss man nackt sein.«
Die Menschen hätten Onkel Flossie sofort verhaftet, wenn sie das gehört hätten. Es war früh am Morgen, der Tag war noch jung (und, ja, unschuldig), Lina trug nur eine kurze Hose und ein T-Shirt, und der alte, ketterauchende Onkel Flossie saß bei ihr und murmelte, dass Nacktheit manchmal unumgänglich sei.
»Weißt du, warum wir die Uniform ablegen müssen, Lina? Weil die Uniform einen nicht stark macht. Weil der innere Kern, das, was unter der Uniform liegt, immer kleiner wird, wenn wir uns nicht entblößen. Herrje, soviel Weisheit von einem dummen alten Mann, und das am frühen Morgen.«
Er schüttelte den Kopf und lächelte. »Meine Dame, es ist Zeit für die Schule, so leid es mir tut. Wie immer war es mir eine Ehre, den Abend mit Ihnen zu verbringen, und ich spüre, dass unsere herrlichen intellektuellen Gespräche nach Fortführung verlangen. Aber jetzt musst du dich der Staatsmacht beugen. Die Schulpflicht ruft.«
Es sollte keine Diskussionen mehr geben.
Herr Steinmann hatte die AG »Gruppe 47« nennen wollen, was er sehr amüsant und geistreich gefunden hätte. Er war Linas Deutsch- und Sozialkundelehrer am Alzeyer Gymnasium »Zum Römerkastell«, ein Mann mit einer merkwürdigen topfartigen Frisur, wie sie kleine Jungen in den Fünfzigern hatten, nachdem ihre scherenschwingenden Mütter sie entstellt hatten. Sein Gesicht sah dadurch noch jünger aus, sodass der Schnurrbart, der seine Oberlippe verunzierte, wie aufgeklebt wirkte. Er trug gerne gestrickte Pullunder, dunkelbraune Cordhosen und ausgelatschte Turnschuhe. Lina war sich nicht sicher, ob das alles nur eine misslungene Verkleidung war. Onkel Flossie hatte ihr vor kurzem bei einer nächtlichen Diskussion im Pyramidenzimmer erklärt, dass sich alle Menschen verkleideten, sobald sie sich in die Öffentlichkeit begaben.
Bei Herrn Steinmann war sie sich jedoch unschlüssig, ob er sich jemals Gedanken über sein äußeres Erscheinungsbild gemacht hatte. Vielleicht wohnte er noch immer bei seiner Mutter, die ihm seine Kleidung jeden Morgen auf einem Stuhl parat legte.
»Gruppe 47«, das hätte Steinmann entzückt. Eine intelligente, doppeldeutige Bezeichnung für seine Stufen übergreifende Arbeitsgemeinschaft. Steinmann war begeistert gewesen, dass sich exakt siebenundvierzig Schüler für sein Sozialkundeprojekt angemeldet hatten. Plötzlich legte man aber zwei der Gruppen zusammen, und mit einem Mal gab es siebenundsechzig Teilnehmer. »Gruppe 67« klang nicht gut und machte auch wenig Sinn.
Zuletzt waren Zweidrittel wieder ausgestiegen, sodass es am Ende nur noch einundzwanzig Personen waren. Entnervt hatte Steinmann die Namenssuche aufgegeben.
Der Klassensaal roch nach gebohnertem Wachs, Kreide und Angstschweiß, ein Geruch, den alle Schulsäle auf dieser Welt gemein hatten. Steinmann stand vorne an der Tafel, an die er in großen Buchstaben die Worte »KZ Osthofen 1933-1934« geschrieben hatte. Neben ihm stand ein kleiner alter Mann mit weißem Haar und extrem faltigem Gesicht. Lina konnte sich nicht daran erinnern, jemals einen Menschen mit so vielen Falten gesehen zu haben. Er trug einen knittrigen schwarzen Anzug, aus dem ein brauner Schlips zungengleich hervorlappte.
Der Mann war etwa fünf Meter von Linas Platz entfernt, dennoch bekam sie seinen Geruch mit; ein chemischer, unangenehmer Geruch, der in der Nase kitzelte. Sie fragte sich, ob das der Duft von Mottenkugeln war, und sie nahm sich vor, Onkel Flossie bei nächster Gelegenheit zu fragen, wie Mottenkugeln rochen. Gerüche, so hatte er mal gesagt, seien möglicherweise das Allerwichtigste im Leben.
Die rund zwanzig Mitglieder der Arbeitsgruppe waren überwiegend Mädchen im Alter zwischen dreizehn und achtzehn Jahren, die gelangweilt an ihren Tischen saßen, in ihre Hefte malten, Kaugummi kauten oder sich leise unterhielten, wenn sie nicht aus dem Fenster in den verheißungsvollen Juli starrten. In der hintersten Reihe saßen zwei Jungen, ungefähr sechzehn Jahre alt, die Lina ein paar Mal auf dem Schulhof gesehen hatte und denen sie stets aus dem Weg gegangen war (aber eigentlich ging Lina jedem aus dem Weg; Sie schloss sich keiner Clique an, hörte lieber Rockmusik über Kopfhörer und marschierte über das Schulgelände zur Rundsporthalle, einem merkwürdigen, futuristischen Gebäude, das wie ein riesiges, schieferschwarzes Ufo anmutete). Die beiden Jungen hießen Axel und Pascal und hatten sich eine fragwürdige Berühmtheit als aufmüpfige Störenfriede erarbeitet. In Wirklichkeit waren es Schläger, immer grimmig dreinblickend, die blonden Bürstenhaarschnitte mit Gel gestylt.
In der ersten Reihe saß Ben Kersky. In seiner schwarzen Kleidung sah er sehr dünn aus. Er war die einzige Person, mit der sich Lina mal länger als fünf Minuten unterhalten hatte, und das, obwohl er schon siebzehn war.
Der alte Mann, den Steinmann zu seinem Projekt in die Schule eingeladen hatte, hieß Levi. Lina merkte ihm an, dass er sich unwohl fühlte. Anscheinend war er es nicht gewohnt, vor Schülern zu sprechen. Glücklicherweise verzichtete er darauf, sich mit aufgesetzt lockeren Sprüchen einzuschmeicheln.
»Sie müssen Folgendes begreifen«, fuhr er seinen vor fast einer Minute unterbrochenen, langsamen Redefluss fort. »Obwohl im KZ Osthofen niemand zu Tode kam, waren schwere Misshandlungen an der Tagesordnung. Während meiner Zeit dort gab es einen Häftling, dem man beide Kieferknochen brach, er konnte fortan den Mund nicht mehr schließen. Ich selbst musste die Jauchegrube mit einer Konservenbüchse ausschöpfen. Die Jauche floss immer wieder zurück, ich wurde nie fertig.«
Das Schweigen breitete sich zentnerschwer in dem schlecht riechenden Raum aus. Levi schielte von den Schülern zu Steinmann, der den Blick auf seine Arbeitsgruppe gerichtet hielt, als wolle er sie telepathisch dazu auffordern, sich zu dem Gesagten zu äußern.
»Zahlreiche Artikel belegen, dass auch die Alzeyer Zeitungen ständig über Osthofen berichteten«, fuhr Levi mit immer leiser werdender Stimme fort. »Die Absichten lagen auf der Hand: Erstens sollte Abschreckung erreicht und zweitens der Nachweis gebracht werden, dass alles nicht so schlimm sei.« Ein merkwürdiges, kaum sichtbares Lächeln erschien in Levis Mundwinkeln. Lina erschrak. Es gefiel ihr nicht, dieses Lächeln in der drückenden Stille.
»Zynisch bezeichnete die Presse das KZ Osthofen als Umerziehungslager für verwilderte Marxisten, mit einer Verköstigung, besser als bei Muttern.« Levi stieß ein raues Geräusch aus, Sand, der über Knochen streift. »Wie die zahlreichen Pressemitteilungen belegen, erfolgten die Errichtung des KZs sowie die Verhaftungen der Gegner des Nationalsozialismus vor den Augen der Alzeyer Bevölkerung, die die Maßnahmen der neuen Machthaber weitgehend zustimmten oder sie zumindest widerspruchslos duldeten.«
Die einsetzende tickende Stille wurde von Steinmanns Organ unterbrochen. »Möchte sich vielleicht jemand von den Herrschaften dazu äußern?« Er klang verärgert. Seine Gruppe kam nicht in Fahrt. Er hatte sich wohl eine rege, emotionale Diskussion gewünscht, schließlich hatten sich die Teilnehmer freiwillig zu diesem Projekt gemeldet. Und nun das: diese offene Demonstration von Desinteresse.
Lina konnte ihn gut verstehen. Sie fühlte sich ebenfalls unwohl. Lag das an Levi? Lag es an seinem monoton hervorgebrachten Bericht? Lag es an den anderen, die Levi mit Ignoranz straften? Und warum sagte sie selbst nichts? Warum wartete sie verzweifelt auf das Läuten der Schulglocke?
»Ich glaube, Sie liefern hier eine ziemlich einseitige Darstellung ab«, ertönte es plötzlich aus der letzten Reihe.
Lina drehte sich um.
Axel hatte die Hände hinter den Kopf verschränkt und grinste. »Offen gestanden«, sagte er, »habe ich genau das erwartet. Himmel, seht mich nicht so an! Ja, es tut mir leid, dass Ihr Leben verpfuscht ist, aber Sie können nicht immer alles auf die Vergangenheit schieben. Immerzu ist die schreckliche, deutsche Vergangenheit an allem schuld. Okay, wahrscheinlich ist damals einiges schief gegangen, das streite ich ja gar nicht ab. Niemand würde das abstreiten. Aber so, wie Sie das vortragen - bei allem nötigen Respekt, aber es ist langweilig und kaum glaubwürdig. Ich ...«
»Okay, Axel«, sagte Steinmann. »Danke für deinen Beitrag, ich denke, das reicht jetzt. Du ...«
Aber Levi hob die Hand. »Nein, das ist schon in Ordnung. Lassen Sie ihn bitte ausreden.«
Axel schenkte Levi ein verächtliches Lächeln. »Danke. Was ich sagen wollte, ist Folgendes: Die Auslegung dieser Zeit ist doch immer einseitig. Was ist beispielsweise mit den Sonderkommandos? Die bestanden aus Juden, nicht wahr? Falls es hier jemand nicht weiß, ein paar Worte zur Erklärung.« Er erhob sich, sonnte sich in den Blicken seiner gaffenden Mitschüler. »Sonderkommandos wurden in den sogenannten Konzentrationslagern gebildet, um Arbeitsdienste zu erledigen und den Betrieb am Laufen zu halten. Die Juden bekamen dafür ausgesprochen großzügige Vergünstigungen, sie waren also an den angeblichen Verbrechen der Nazis aktiv und bewusst beteiligt. Sie ...«
»Wir unterhalten uns hier nicht über Sonderkommandos!« Steinmanns Stimme erklang mit jedem Wort lauter. Lina glaubte, dass er die neue Situation nur langsam erfasste. Beunruhigend.
»Nein, wir unterhalten uns nicht über Sonderkommandos. Leider.« Axel schlenderte um seinen Stuhl herum, als wäre er der Showmaster einer Quizsendung. »Aber das hängt doch alles zusammen. Wir ...«
»Du weißt doch gar nichts über die Sonderkommandos«, erklang Bens Stimme. »Du spielst dich bloß auf.«
Axels Miene verzog sich zu einem breiten, höhnischen Grinsen. »Ach, Herr Kersky! Sieh mal einer an.«
»Es gibt keinen Grund, die Sprache auf die Sonderkommandos zu bringen. Darum geht es nicht. Außerdem stimmt das, was du da behauptest, in keiner Weise.«
»Was du nicht sagst! Weißt du es etwa besser?«
Erst jetzt blickte Ben auf. »Ich weiß es besser.«
Steinmann versuchte, die Situation zu retten, aber es war zu spät. »Hört mal, Jungs, Schluss jetzt. Wir sind ...«
»Das habe ich von dir erwartet, Kersky. Weißt du, was das Problem in diesem Land ist? Die Deutschen leben nicht in der Gegenwart.« Er ließ seinen verächtlichen Blick von Ben zu Levi gleiten. »Das Ausland betrachtet die Deutschen immer noch als Kriegsverbrecher. Dabei haben Leute in unserem Alter mit der Vergangenheit überhaupt nichts am Hut. Deswegen ...«
Mit einem Satz erhob sich auch Ben. »Komm mir nicht so«, rief er. »Ich kenne Typen wie dich!«
Axel stieß ein schrilles Lachen aus. »Ach, du kennst Typen wie mich? Interessant. Jetzt will ich dir mal was sagen, Kersky. Wenn die Juden nicht ein so aggressives Verhalten an den Tag gelegt hätten, wären die Nationalsozialisten nie auf die Idee gekommen, entsprechend zu reagieren. Wir erleben heute dasselbe. Warum brennen denn die Ausländerwohnheime? Warum?«
Lina fühlte sich mit jedem Satz, den Axel ausspie, unbehaglicher, aber gleichzeitig faszinierte sie das Schauspiel. Warum sagten Steinmann und Levi nichts? Warum starrten die anderen die beiden so dämlich an?
Sie öffnete probehalber ihren Mund, aber es kam nur Luft heraus. Ihr Magen krampfte sich zusammen.
»Immerzu verfolgt uns die Vergangenheit! Immerzu werden wir klein gehalten, und dann kommt ein windiger Jude daher, zieht ein betroffenes Gesicht und versucht, uns allen ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich sage euch was: Damit ist jetzt Schluss! Ich ...«
»Ich mache niemandem ein schlechtes Gewissen«, sagte Levi. Er klang noch immer ruhig, ein wenig müde vielleicht, als hätte er derartige Diskussionen zur Genüge erlebt. »Aber man darf nicht vergessen, Junge. Mir ist vollkommen bewusst, dass Sie ein schweres Los zu tragen haben. Schon als junger Mensch haben Sie eine enorme Verantwortung. Aber Sie sollen nicht in Scham zurückblicken. Ich freue mich, wenn ich junge Menschen treffe und mich mit ihnen unterhalten kann. Ich möchte Sie nicht Ihrer Identität berauben, sondern Sie dazu aufmuntern, verantwortungsvoll in die Zukunft zu ...«
»Blablabla!«, schrie Axel. Sein Kumpel, der noch auf seinem Platz saß, stieß ein kehliges Lachen aus. »Ich sag Ihnen was, Herr Levi! Mir steht's bis hier. Sie können Ihre Propaganda gerne fortführen, aber ich sage Ihnen, das wird nichts nützen.«
Steinmann erwachte aus seiner Starre. »Okay, Axel, das reicht jetzt wirklich! Würdest du bitte den Saal verlassen und uns von deiner Gegenwart befreien! Das ist ja unerträglich.«
»Mein Vater ist seit zehn Jahren arbeitslos! Und warum? Was unternimmt der Staat gegen die Arbeitslosigkeit?«
»Du kannst niemanden dafür verantwortlich machen, dass dein Vater ein stadtbekannter Alkoholiker ist«, sagte Ben. »Vielleicht sollte er etwas in seinem Leben verändern, anstatt ...«
»MEIN VATER! MEIN VATER HAT DIESE SCHEISSE SCHON LANGE SATT!«
»Axel, bitte nicht in diesem Ton!« Steinmann wich weiter in Richtung Tafel zurück.
Bens Augen verengten sich zu schmalen Sicheln. »Du bist so dumm wie deine Eier, Axel. Du wirst genauso enden wie dein Alter. Du verstehst gar nichts.«
Axel stieß ein gackerndes Geräusch aus, das Lina erst beim zweiten Hinhören als Lachen identifizieren konnte. »Ich bin dumm, was?«
»Ja«, sagte Ben. »Ziemlich.«
Axels Hand schoss in die Höhe, und einen Moment lang dachte Lina, er wolle den rechten Arm heben und »Sieg Heil« rufen, aber er deutete nur auf Ben, der in seinen schwarzen Klamotten dastand, als wäre nichts Besonderes geschehen. Er machte den Mund auf, schloss ihn wieder, lächelte.
Nie zuvor hatte Lina eine derartig gefährliche, wortlose Warnung gesehen.
In der Pause kaufte sich Lina am Schulkiosk eine Caprisonne und ein Käsebrötchen und spazierte zur Wiese, die sich hinter dem Hauptgebäude der Schule befand. Die Sonne stand wie eine Perle am Sommerhimmel. Auf dem Rasen spielten jüngere Schüler Fußball oder Fangen, oder sie standen einfach nur herum und schauten düster drein.
Lina lief zum Rand der Wiese. Eine dichte Gebüschwand grenzte sie vom nächsten Grundstück ab. Hierher verirrte sich selten jemand. Sie setzte sich auf ein kleines, vergessenes Mäuerchen, neben dem sich ein altes Metalltor befand, das zu einem Hinterhof führte. Sie zog sich den Kopfhörer von den Ohren und strich sich das rote Haar zurück - als sie die Stimmen vernahm.
»Du kamst dir dabei wohl ziemlich heldenhaft vor. Bist mal wieder in sämtliche Ärsche gekrochen. Ich sag dir jetzt was, Kersky, und weil ich es dir sage, sage ich es laut: Du befindest dich nicht unbedingt in der Situation, in der du dir solche Auftritte leisten kannst.«
Axel, irgendwo hinter der Gebüschwand.
Ein dumpfer Schlag, ein ersticktes Keuchen.
»Dafür, dass du dein Maul nicht halten kannst.« Wieder ein dumpfer Schlag. »Und das dafür, dass du dein verficktes Maul nicht halten kannst!«
Lina schlich die kleine Anhöhe hinauf und zog die Zweige der Gebüsche auseinander.
»Du sagst nur etwas, wenn ich es dir gestatte. Wenn nicht, könnte ich ja versehentlich ein paar von deinen kleinen Geheimnissen ausplaudern. Wie war das denn damals mit deiner Mutter, hm?«
Axel und Pascal hatten sich vor Ben aufgebaut. Ben sah erschreckend klein aus, noch jünger und weicher als sonst. Axel hielt ihn am Kragen seines schwarzen Kapuzenpullis fest, Pascal stand mit den Händen in den Hosentaschen neben ihm und grinste. In seinem Mundwinkel hing eine Zigarette. Es sah aus, als könne sie jeden Moment zu Boden fallen.
Ben lehnte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht vornüber und rang nach Luft. Er hielt die Augen geschlossen.
Axel führte die Lippen an sein Ohr. Sein Gesicht war rot angelaufen.
»Das war meine letzte Warnung, du Schwuchtel. Wenn du bei mir einkaufst, hast du dich zu benehmen. Und was deine Aktivitäten und Interessen angeht: Sieh dich vor. Ich behalte dich im Auge.«
Er langte Ben zwischen die Beine.
Lina zog die Äste auseinander und trat einen Schritt nach vorne. »Hallo.« Sie vernahm ihre fremd klingende Stimme wie aus weiter Ferne. »Was macht ihr denn hier?«
Axel und Pascal wirbelten herum. Einen Moment lang sahen sie erschrocken aus, doch dann grinsten sie.
»Schau, schau, schau! Wen haben wir denn hier? Die schlafende Hässlichkeit.« Pascal lachte wie nicht mehr ganz dicht, und zuerst dachte Lina, er habe einen hysterischen Anfall. »Verpiss dich, Kessler. Das hier geht dich nichts an.«
Ben, der zu Boden gesunken war, rang noch immer nach Atem. Das dunkle Haar fiel ihm ins Gesicht. Er blickte nur eine Sekunde lang auf.
»Die hat aber schon ganz ordentliche Titten«, sagte Pascal. Axel lachte.
»Das ist wahrscheinlich der längste zusammenhängende Satz, den du jemals von dir gegeben hast«, sagte Lina. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und in ihrem Innern begann eine Stimme, vor Panik zu schreien.
Pascal sah sie mit dumpfem Blick an, ein Fragezeichen ohne Punkt, während Axel die ausdruckslose Mimik eines Berufsboxers zu kopieren versuchte. Lina konnte die Kopfhaut durch sein kurzes gegeltes Haar schimmern sehen. Über seiner linken Augenbraue befand sich ein Leberfleck.
»Hör zu, Kleine. Hau ab. Wenn nicht, geschieht hier gleich ein Unglück.«
Man darf keine Angst davor haben, nackt zu sein , hallte Onkel Flossies Stimme in Linas Ohren nach.
Ihre Hand schnellte nach vorne. Sie bekam Axels glatten Hals zu fassen. So fest sie konnte, drückte sie zu.
Axel begann zu röcheln, er verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.
Ohne zu zögern, trat ihm Lina mit voller Wucht in die Weichteile. Er stieß ein helles Geräusch aus und versuchte, sich zu einer embryonalen Haltung zusammenzurollen, aber Lina legte sofort nach. Diesmal erwischte sie ihn mit dem Turnschuh am Kinn.
Blitzschnell fuhr sie herum. Pascal glotzte wie ein geistig Behinderter. Mit dem Ellenbogen schlug ihm Lina gegen den Unterkiefer. Sie vernahm ein deutliches Knacken. Eine Sekunde später schoss Blut aus seiner Nase.
Entsetzte hielt er sich die Hände vors Gesicht, die sich rot färbten, und streckte sie Lina entgegen, als wolle er sagen: Sieh nur, was du getan hast!
Axel arbeitete sich auf die Beine, rutschte die Anhöhe hinab und verschwand in den Gebüschen. Einen Moment lang stand Pascal blutend da, dann folgte er ihm.
Von der Wiese ertönte das Geräusch spielender Kinder. Lina fuhr sich über das Gesicht, das sich plötzlich kochend heiß anfühlte. Es erschreckte sie, wie stark ihre Hände zitterten.
Sie kniete neben Ben nieder, der sich hingesetzt hatte und sich mit einer raschen Bewegung die Tränen von den Wangen wischte.
»Alles in Ordnung?«
Ben spuckte eine kleine Kugel aus Speichel und Blut aus. »Danke.« Er sah sie an. »Die beiden haben ... es war so, dass ...«
»Miese Scheißkerle«, sagte Lina. Die Hitze wanderte von ihrem Kopf in ihren Körper, und sie fragte sich, ob sie jetzt ohnmächtig werden würde.
Ben lächelte. Es war ein klitzekleines Lächeln und kurzlebig, aber es war da. Er stand auf und klopfte sich die Hosen sauber. »Danke«, sagte er noch einmal.
Lina fand, dass er wie ein Ertrinkender klang, der sich mit letzter Kraft auf ein Atoll gerettet hatte.
Von Anfang an schien er mehr als nur ein Geheimnis zu haben.
Lina schloss die Haustür. Der Geruch nach verkochtem Kohl schlug ihr entgegen.
Sie tanzte durch den Flur, warf ihren Rucksack in eine Ecke und drehte sich im Kreis.
Sie dachte an Ben, Ben, Ben. Sie dachte daran, wie schrecklich jung er aussah, als bestünde er aus Cellophan, ein Junge mit großen, dunklen Augen, immer schüchtern dreinblickend.
Aber hinter dieser Schüchternheit schlummerte etwas.
Himmel, sie würde ihn treffen, er hatte sie zu sich eingeladen! Der seltsame Junge mit dem ängstlichen Lächeln hatte sich mit ihr verabredet!
Linas Mutter, eine tropfenförmige Frau mit kurzen Haaren, stand in der Küche und machte den Abwasch. Ihr Vater befand sich wahrscheinlich in seinem Kellerzimmer, wo er darüber nachgrübelte, was aus seinen Träumen geworden war.
»Lina«, rief ihre Mutter. »Bist du das?«
Himmel, wer sollte es denn sonst sein?
Lina betrat die Küche. Ihre Mutter musterte sie und fragte: »Bist du schon daheim?«
Lina hatte das Bedürfnis zu sagen, nein, das sei nur ihr Geist. Sie versuchte, Bens merkwürdiges Lächeln zu kopieren. Sie wusste nicht, ob es ihr gelang, aber es fühlte sich gut an. Sie öffnete den Kühlschrank und suchte nach einem kleinen Snack.
»Dein Vater ist noch einkaufen, bist du zum Abendessen da? Übrigens, jetzt halt dich mal fest: Gerhard ist gestorben, ganz überraschend.«
Lina biss in ein Stück Camembert. »Wer ist gestorben?«
»Dein Onkel Gerhard. Ganz überraschend. Herzinfarkt. Schlimm, schlimm, schlimm, was so alles passieren kann. Aber er hat ja auch geraucht wie ein Schlot.«
»Ich kenne keinen Onkel Gerhard.«
»Aber natürlich kennst du ihn.« Ihre Mutter trocknete einen Teller ab, als wolle sie ihn auf Hochglanz polieren. »Du hast doch heute bei ihm übernachtet. Ging es ihm da noch gut?«
Lina war verwirrt. »Ich war bei Onkel Flossie, nicht bei Onkel Gerhard.« Was faselte ihre Mutter da eigentlich?
»Von dem rede ich doch!« Der Ton ihrer Mutter gefiel Lina überhaupt nicht. Ihre Stimme klang plötzlich scharf, als rege sie sich darüber auf, dass ihre Tochter so schwer von Begriff war. »Gerhard ist tot. Herzinfarkt. Was so alles passieren kann. Schlimm, schlimm, schlimm.«
Gerhard ist Onkel Flossie , dachte Lina. Ihr Kopf war in Watte gehüllt.
Das musste ein Irrtum sein.
»Aber«, brachte sie hervor. »Aber ...«
»Gerhard Flossenburger. Mensch, Lina! Mein Bruder. Wir standen uns nicht besonders nahe. Ich glaube fast, du kanntest ihn besser als ich. Schlimm, was so alles passieren kann. Schlimm, schlimm, schlimm.«
Die Erkenntnis traf sie wie ein Genickschlag. Lina drehte es den Magen um, plötzlich gab es keinen Sauerstoff mehr in der engen, nach Kohl riechenden Küche. Das Haus atmete tief ein, stahl ihr die Luft. Ihre Beine verwandelten sich in Pudding, alles drehte sich.
»Onkel Flossie?« Ihre Stimme klang wie von weit her.
»Ja, genau. Onkel Flossie, herrje, so hast du ihn ja immer genannt. Er ist ganz überraschend ... schwupps, einfach umgefallen und war nicht mehr.«
»Ganz einfach umgefallen? Und war nicht mehr?«
Lina fühlte sich wie in einem Traum gefangen. Was spielte ihre Mutter da für ein Spiel? War das eine Prüfung?
»Er war schon ein sonderbarer Kauz. Lina? Ist alles in Ordnung? Setz dich mal.«
Lina spürte kaum, dass ihre Mutter sie zu einem Stuhl führte. Sie machte den Mund auf, aber es kam nur ein Fiepen heraus.
»Geht's dir auch wirklich gut? Du hast wieder nicht richtig gegessen, stimmt's?«
»Onkel Flossie ... hat mich doch heute noch zur Schule gebracht. Er ist nicht tot.«
»Doch, ist er.« Emotionslos, glatt. »Tot. Schlimm.«
Lina blickte ihrer Mutter in die Augen, suchte nach einer heimtückischen List, einem gemeinen Scherz, den sie ihr spielte.
»Du lügst!«
Ihre Mutter blickte zur Wanduhr. »Ach du meine Güte, schon so spät. Ich muss mich um das Essen kümmern. Bist du zum Abendbrot da?«
Im Zeitlupentempo stand Lina auf. Sie schien Tonnen zu wiegen. »DU LÜGST!« Sie versuchte sich an Bens Lächeln, aber es funktionierte nicht.
Stattdessen brach sie in Tränen aus.
Lina hatte den Alzeyer See immer gemocht. In den vergangenen Jahren war sie oft hier hergekommen, um ihre kochenden Gedanken abzukühlen. Hier hatte sie ihre Ruhe. Nur am Wochenende verunstalteten Familien mit kreischenden Kleinkindern und kackenden Hunden das Bild. Irgendwie sah es hier aus wie auf einem Plattencover von Pink Floyd, fand Lina. Auf einer der beiden kleinen Inselchen stand eine große Trauerweide, in der hunderte von Raben krächzten, und im Winter hatte sie Eisvögel gesehen, die über die gefrorene Fläche geflitzt waren, fliegende Diamanten. Das Betonstaubecken und die nahe Autobahnbrücke verliehen dieser Gegend eine Art Endzeitstimmung. Es sah nicht aus, als hätte der Mensch diese hässlichen Bauten aufgestellt, um die Natur zu beherrschen - es war umgekehrt. Die Menschheit war ausgestorben, und die Flora hatte ihr Gebiet zurückerobert.
Lina stand an dem Betonstaubecken und starrte in die Tiefe, wo das Wasser durch zwei fette Röhren plätscherte. Unzählige riesige Spinnen hatten dort ihre Netze gesponnen.
Die Sonne ging unter, die Schatten wurden länger, und die Luft schmeckte nach gemähtem Gras. Die Wolken zogen sich hinter der Brücke zusammen. Vielleicht würde es regnen.
Lina trug noch immer ihre Jeans und das T-Shirt vom Morgen. Die gleichen Turnschuhe.
Sie lief zum Seeufer. Enten schwammen im giftgelben Licht des wolkenverhangenen Sonnenuntergangs. Sie interessierten sich nicht dafür, dass Onkel Flossie tot war.
Lina hatte den Rest des Tages wie in Trance zugebracht. Stundenlang hatte sie in ihrem chaotischen Zimmer auf dem Bett gelegen und sich Platten von Johnny Cash angehört. Sie hatte sich Arthur, ihren Stoffrochen, den sie liebte, weil er so mürrisch dreinblickte, an die Brust gepresst und geweint. Sie hatte versucht, an ihrer Staffelei, die ihr Onkel Flossie zu Weihnachten geschenkt hatte, ein Bild zu malen, aber nach wenigen Pinselstrichen hatte sie aufgegeben und die Palette gegen die Leinwand geworfen.
Sie hatte das nach Kohl stinkende Haus verlassen und war durch die Weinberge geirrt.
Stimmen flüsterten in ihrem Kopf.
Er ist nicht tot, er kann gar nicht tot sein, nicht Onkel Flossie ...
Doch Lina. Er ist tot. Finde dich damit ab.
Er ist nicht tot ...
Es gibt zwei Sphären, Lina, niemals und ewig, und zwischen Geburt und Tod lebt der Schmerz. Das hat Onkel Flossie mal gesagt, weißt du noch? Wie willst du diesem Schmerz jetzt noch entgehen?
Er ist nicht tot ...
Lina senkte einen Fuß in das Seewasser. Es war überraschend kalt. Der Schlamm am Grund war rutschig und schien unter ihrem Gewicht wie Gelee nachzugeben.
Vielleicht würde es Wochen dauern, bis man sie finden würde. Ihre Eltern würden vielleicht nach zehn Tagen eine Vermisstmeldung rausgeben (vielleicht auch erst nach sieben Wochen), und wenn man schließlich ihren Körper im Schilf entdecken würde, käme die Frage auf, wie so etwas Schreckliches hatte geschehen können. Man würde zunächst auf einen Unfall tippen, doch dann würde ein findiger Ermittler die Frage aufwerfen, was das arme Mädchen am See verloren hatte. Man würde an ein Verbrechen denken, aber dafür gäbe es keine Anzeichen. Schließlich würde der Ermittler zu ihren Eltern fahren und sie fragen, ob Lina seelische Probleme gehabt hätte.
»Nein, gar nicht. Lina war wie immer. Okay, eine Sache - sie war verhaltensgestört. Eine verhaltensgestörte Träumerin. Träume sind Minderwertigkeitskomplexe.«
»Ich denke, es hat etwas mit dem plötzlichen, schrecklichen Tod ihres sympathischen Onkels zu tun«, würde der Ermittler sagen (Lina stellte ihn sich mit Hut und langem Mantel vor, wie ein Detektiv aus den Schwarz-Weiß-Filmen, die sie so gerne sah). »Wissen Sie, die beiden standen sich sehr nah. Haben Sie mal daran gedacht, dass Ihre arme Tochter freiwillig aus dem Leben geschieden ist? Weil sie wieder mit ihrem Onkel zusammen sein wollte? Weil ihr sonst niemand zugehört hat! Sie am allerwenigsten! Weil Sie so unfassbar dumm und egozentrisch sind! Ich sage Ihnen jetzt was - Ihr Großes Egal hat Ihre Tochter ermordet! Sie sind verhaftet.«
Und Linas traumatisierter Geist würde über der blanken Fläche des Sees schweben bis in alle Ewigkeit.
Lina machte einen Schritt nach vorne.
Ertrinken tat bestimmt weh. Woran würde sie in den letzten Sekunden denken?
Woran hatte Onkel Flossie gedacht, als sein Herz plötzlich ins Stolpern geraten war? Wie hatte es sich angefühlt? Hatte er an sie gedacht?
Eine Ente flog über ihren Kopf hinweg. Lina fand, dass es schön aussah. Mein letztes Bild, dachte sie und schloss die Augen.
»Hey, hallo«, erklang eine Stimme hinter ihr. Sie wirbelte herum, verlor das Gleichgewicht und fiel nach vorne. Mit den Knien landete sie im trüben Wasser, das ihr ins Gesicht spritzte.
Hinter ihr stand Ben Kersky in weißen Turnschuhen, die sich leuchtend von seinen schwarzen Klamotten abhoben. Sein zu langes, braunes Haar flatterte im aufkommenden Wind. Tiefe Ringe lagen unter seinen Augen. Er hielt ein dunkles Etwas im Arm, das Lina als Stoffraben identifizierte.
»Ach ... äh, du bist es.« Die Worte kamen ihr reichlich bescheuert vor. »Ich ... ähm, ich habe einen Fisch gesehen.« Große Güte! »Einen Fisch, ja. Einen ganz großen Fisch.« Sie rappelte sich auf und kam ans Ufer gewatet. Ben hielt ihr die Hand entgegen, aber sie ergriff sie nicht. Sie wollte ihm beweisen, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gab; dass sie die Situation unter Kontrolle hatte und er wieder abdampfen konnte.
»Du bist nass geworden«, sagte er, als sie triefend neben ihm stand. Ihre Schuhe waren voller Wasser, und es knatschte bei jedem Schritt.
»Ja, wenn man sich Fische anschaut, wird man für gewöhnlich nass!«
Ben kramte in seiner Hemdtasche und zog ein Päckchen Zigaretten hervor. Er hielt es Lina hin.
Lina rauchte nicht. Sie hatte mal an einer von Onkel Flossies Zigarren gezogen und einen dramatischen Erstickungsanfall bekommen.
Sie nahm trotzdem eine. Ben gab ihr Feuer. Lina spuckte den Rauch schnell wieder aus, damit er nicht in ihre Lungen geraten konnte.
»Hast du Lust, ein bisschen spazieren zu gehen?« Ben sprach leise, gar nicht wie heute Morgen in der Schule (als Onkel Flossie noch am Leben gewesen war).
»Nein! Wegen dir ist mein Fisch jetzt weg!« Ihre Äußerungen wurden immer intelligenter. »Was ist das überhaupt für ein Vieh da?« Sie deutete auf den Stoffraben.
»Oh, das ist ... nun, mein Rabe. Tut mir leid, das mit deinem Fisch.«
Lina bemerkte, dass Bens Augen blutunterlaufen waren. Hatte er geweint?
Der Wind wehte um ihre triefende Hose, ihr wurde kalt.
»Ich setz mich ein bisschen auf die Bank da«, sagte Ben. »Ich hock gerne hier. Schau mir den Sonnenuntergang an. Dann wird man so schön ruhig.«
Er lief zu der Bank und ließ sich nieder. Einen Moment lang stand Lina blöd in der Gegend herum. Die Stimmen in ihrem Kopf wussten mit dieser neuen Situation nicht umzugehen. Eigentlich sollte sie jetzt auf dem Grund des Sees liegen.
Sie zog an ihrer Zigarette und inhalierte. Ihre Beine verwandelten sich in Wackelpudding.
Warum war Ben Kersky hier? Und warum sah er so erschreckend jung aus? Was sollte dieser dämliche Stoffrabe?
Warum hatte er geweint?
Lina ging zu ihm, setzte sich neben ihn, versuchte, die gleiche Haltung einzunehmen, wobei sie fast von der Bank rutschte.
»Danke noch mal für heute Morgen«, sagte er. »Diese beiden Idioten. Die hätten mich fertig gemacht, wenn du nicht gekommen wärst.«
Ben sah sie von der Seite an. Auf seinem Gesicht stand ein kleines, fast unsichtbares Lächeln.
»Was wollten die Typen eigentlich von dir?«, fragte Lina.
»Geld.«
»Geld? Hast du bei denen etwa Schulden?«
»Ja.«
Die Antwort kam so unvermittelt, dass Lina nicht wusste, was sie erwidern sollte.
»Grasschulden, wenn du verstehst. Knapp 200 Mark. Die waren nicht gerade erfreut, als ich ihnen heute Morgen so in die Parade gefahren bin.«
»Du kiffst?«
»Ich versuche, es mir abzugewöhnen. Bringt nichts. Irgendwie macht mich das Zeug ...« Ben streichelte seinen Raben. »Wie geht's dir?«
Himmel, was war das denn für eine Frage? Was wollte dieser Kersky von ihr? In Lina zog sich alles zusammen.
»G-G-Gut«, brachte sie hervor. In ihrer Kehle wuchs ein Kloß.
Nicht heulen, jetzt nicht heulen, dann rennt er weg, und du willst doch nicht, dass er wegrennt, oder noch schlimmer, er nimmt dich in den Arm und tröstet dich, um eine Nummer zu schieben, genau das ist nämlich seine Absicht! Er zieht hier nur eine Nummer ab. Er hat gar nicht geweint, er hat gekifft, hat er ja zugegeben, also sieh dich vor!
»Du siehst nicht so taufrisch aus.« Ben lehnte sich zurück, betrachtete einen unsichtbaren Punkt in der Ferne. »Ist was passiert?«
»Überhaupt absolut gar nichts.«
Ben zog an seiner Zigarette. »Heute vor sechs Jahren ist meine Mutter gestorben. Depressionen. Ich war elf Jahre. Kam von der Schule. Sie war im Badezimmer, ich hörte Wasser laufen. Wir haben kein zweites Klo, und ich musste mal ziemlich dringend pissen. Hab die ganze Zeit gegen die Tür gehämmert. Konnte sie stöhnen hören. Irgendwann kam mein Vater nach Hause. Hat die Tür aufgebrochen. Hab nur kurz reinschauen können. Alles voller Blut, die Wände, die Kacheln, die Gardinen. Das Wasser, in dem sie lag, war rot. Mein Vater hat gesagt, ich solle schnell unseren Hausarzt rufen. Hab ich gemacht. Als ich zum Bad zurückkam, stand mein Vater davor und meinte, ich solle keine Angst haben und in mein Zimmer gehen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war sie schon tot.«
Er erzählte es völlig emotionslos, wie ein Nachrichtensprecher.
»Hab lange gedacht, ich wäre schuld. Weil ich sie stöhnen hörte. Da hat sie noch gelebt. Ich hätte nur schneller einen Arzt rufen müssen. Hab ich aber nicht. Und außerdem hab ich ... ich habe ...« Er ließ den Satz verklingen. »Das ist jetzt sechs Jahre her.« Er schloss die Augen.
»Warum erzählst du mir das?« Der Kloß in Linas Hals hatte beängstigende Ausmaße angenommen. Als sie die Luft einsog, erklang ein heiseres Keuchen.
»Weiß nicht. Weil du da bist. Weil wir hier am See sitzen. Weil du gerade in den See marschieren wolltest. Tut mir leid.«
»Bist du deswegen hier? Wegen deiner Mutter?«
Ben setzte sich den Stoffraben auf die Schulter. »Normalerweise trinke ich ein paar Bier und rauche einen Joint, aber heute nicht. Ich hatte das Gefühl, wenn ich mir die Kanne gebe, passiert etwas, das ich in Wirklichkeit nicht will. Dass ich in den verdammten See reinlatsche oder so, keine Ahnung. Um diesem ganzen Unsinn zu entkommen, weil ... Warum bist du hier?«
»Kann ich noch eine Zigarette bekommen?«
Ben holte das Päckchen aus seiner Hemdtasche und warf es Lina in den Schoß. Sie fischte eine Kippe heraus, steckte sie sich in den Mund und zündete sie an.
»Warum erzählst du mir das? Was willst du von mir?«
»Ich will gar nichts. Wir reden nur.«
»Wieso?«
»Keine Ahnung.«
Lina betrachtete die Glut ihrer Zigarette. Um sie herum wurde es allmählich richtig dunkel, Grillen begannen, in den Gräsern zu zirpen.
»Hast du deine Mutter gern gehabt?«
»Sie war ... sie war ...« Seine Stimme wurde so leise, dass Lina die letzten Worte nicht verstehen konnte.
»Ich kann meine Eltern überhaupt nicht leiden!« Lina zuckte zusammen. Himmel, wie kam sie dazu, so etwas einem Fremden zu erzählen? Und stimmte das überhaupt? »Ich mag das Haus nicht, in dem ich lebe. Es stinkt nach Kohl. Ich mag es nicht, dass mir meine Eltern nicht zuhören. Ich mag es nicht, dass sie mich nicht ernst nehmen. Sie leben in einem Großen Egal. Heute ... heute ist ... ich habe ... hatte einen Freund ... Onkel Flossie ... er war ganz anders ... ich war dauernd bei ihm ... er ist gestorben ... es war ihnen egal ... und es irritiert sie in ihrem Großen Egal, dass es mir nicht egal ist ... ich ... ich ...«
Sie sagte: »Onkel Flossie ... was für ein doofer Name, er mochte Fische nicht mal sonderlich, von wegen Flossie ...« Sie versuchte sich an einem Lachen, aber es kamen Tränen. »Onkel Flossie ist tot. Er war der einzige Mensch, der mir zugehört hat. Ich bin allein und sitze mit dir am verdammten Alzeyer See, und er ist tot.«
Er nahm sie nicht in den Arm, betrachtete sie nur ruhig, aufmerksam.
Und dann stürzte plötzlich alles auf sie ein. Es war wie ein Vulkanausbruch. Sie schlang die Arme um Bens Hals, sodass sie fast von der Bank kippten, das Schluchzen rollte in ihre Kehle, brodelte hervor, sie schloss die Augen und fiel rückwärts in ein Loch, das tief und schwarz war.
»Er ist tot!« Sie krallte sich an Bens Hemd. »Onkel Flossie ist tot!«
Das Grausame war ausgesprochen, und der Schmerz war da, endlich war er da, unverfälscht und brutal. Es raubte Lina den Atem, die Vorstellung, dass Onkel Flossie tot, aber noch immer ein wirklicher Name war, dass er möglicherweise in der Sprache (und in den Gerüchen) weiterleben würde wie in einer eisernen Lunge.
Ben streichelte sanft ihren Rücken, ganz sanft.
Er sprach kein Wort.
Es dauerte Minuten, bis sie sich wieder beruhigt hatte. »Tut mir leid«, sagte sie und zog die Nase hoch. »Tut mir leid, ich wollte nicht ...«
Ben reichte ihr ein Taschentuch und ließ seinen Raben mit dem Flügel winken. »Das ist Hugin«, sagte er. »Entschuldige, ich hab euch noch gar nicht vorgestellt. Hugin, das ist Lina.«
»Hu-Hu-Hugin?«
»Ja.« Er setzte den Raben auf Linas Schulter. »Kennst du dich mit Sagen aus?«
»Mit Sagen?«
Hugin schmiegte sich an Linas Hals, sodass es kitzelte.
»Odin war der Götterkönig der Germanen, und er war ziemlich wissensdurstig. Sein linkes Auge verpfändete Odin für das Recht, aus der Quelle der Weisheit zu trinken, um Kenntnis über das urzeitliche Wissen zu erlangen. Sein Wissensdurst war so groß, dass er täglich seine beiden Raben, die links und rechts auf seinen Schultern saßen, in alle Reiche, über die er herrschte, entsendete, damit sie ihm nach ihrer Rückkehr von den großen Geheimnissen der Welt berichteten. Ihre Namen waren Hugin und Munin.«
»Und wo ist Munin?« Lina schnäuzte sich.
»Oh, der ist daheim. Er schläft.«
Lina schaffte ein Lächeln. Sie nahm Hugin und ließ ihn mit den Flügeln flattern.
»Weißt du, dass du ziemlich merkwürdig bist?«
Ben erwiderte ihr Lächeln.
Lina blickte den engen, schlauchartigen Raum entlang. Um sie herum war es so still geworden wie in einem U-Boot auf dem Grund des Meeres.
Sie holte eine Zigarette aus ihrer Tasche und zündete sie an. Es war nicht gut, den Raum mit Rauch zu schwängern, aber sie glaubte, verrückt zu werden, wenn sie jetzt kein Nikotin bekam.
Sie lehnte sich gegen das zerbrochene Weinfass zurück und nahm den blutverschmierten Raben in den Schoß.
»Er hatte von Anfang an mehr als ein Geheimnis«, sagte sie. »Aber das mochte er. Er liebte seine Geheimnisse. Er bemerkte nicht, dass sie ihn ertränkten. Sonst wäre es nicht so weit gekommen, was meinst du, Hugin?«
Der Rabe wusste darauf keine Antwort.
»Aber an diesem Tag hat er mir sofort einen Teil seiner Geheimnisse anvertraut. Wenn man zu viele Geheimnisse hat, erdrücken sie einen. Er musste etwas davon abgeben.
Wir sind danach um den See herumgelaufen. Mittlerweile war es stockfinster. Wir haben uns unterhalten, über Comics, kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie lange ich in seinen Armen geweint habe, aber danach war alles besser. Ich saß am Alzeyer See auf der Bank und wusste zum ersten Mal in meinem Leben, dass die schlimmsten Dinge wirklich geschehen. Menschen können verschwinden. Menschen können sterben. Aber ich, so dachte ich, ich würde nicht sterben. Sterben kann jeder Trottel. Da hast du es wieder, Hugin. Das Pathos eines pubertierenden Mädchens. Ich wusste damals nicht, was wirklich schlimme Dinge sind.
Die kamen erst später.«
Lina drückte die Zigarette auf dem Boden aus und stürzte sich in die Erinnerung.
Sie schrieb:
Keine Ahnung, wie wir auf Comics zu sprechen kamen. Wir waren bis nach Mitternacht unterwegs, sprachen nicht über Abgründe.